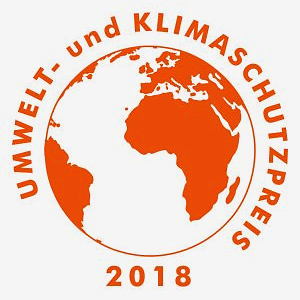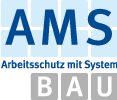Kalte Nahwärmenetze mit oberflächennaher Geothermie

Pionierarbeit bei der Entwicklung von Kalten Nahwärmnetzen
Es gehört zu den Grundwerten der Unternehmensgruppe Gemünden/Molitor, nachhaltige Technologien und Ideen für das Bauen und Wohnen früh zu identifizieren und diese anschließend mit hohem eigenen Invest und Engagement zu marktreifen Lösungen zu entwickeln und anzuwenden. Die Pionierarbeit auf dem Gebiet Kalter Nahwärmenetze ist ein Beispiel dafür.
Es waren Forschungsergebnisse von Prof. Dipl.-Ing. Thomas Giel, die die großen Potenziale der Nutzung von Kalten Nahwärmenetzen für das Heizen und Kühlen von Gebäude belegten. In den Jahren 2007 bis 2010 hatte er sich gemeinsam mit seinem Team mit dieser innovativen Form der Geothermie intensiv auseinandergesetzt. Mit Gemünden/Molitor fand er einen visionären Unternehmenspartner für die bauliche und wirtschaftliche Realisierung dieser zukunftsweisenden Technik.
Seither hat die Unternehmensgruppe Gemünden/Molitor bereits weit über 30 Bauprojekte mit Kalten Nahwärmnetzen umgesetzt. Die für jedes Projekt maßgeschneiderten Energiekonzepte werden in der zur Unternehmensgruppe Gemünden /Molitor gehörenden Haustechnikplanungsgesellschaft GTR GmbH entwickelt.
Der Proof of Concept (Vorhaben prinzipiell realisierbar) ist also längst erbracht: Kalte Nahwärmnetze haben das Potenzial, einen entscheidenden Beitrag zu einer flächendeckenden, nachhaltigen Energieversorgung zu leisten.
Was ist Geothermie?
Geothermie ist die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie. Um sie nutzbar zu machen, gibt es verschiedene technische Verfahren. Unterschieden wird dabei vor allem nach der Erschließungstiefe und danach, ob es sich um geschlossene Kreisläufe handelt oder ob Grundwasser aktiv gefördert wird. So unterscheidet man zwischen Geothermie über Flächenkollektoren, über Grundwasserbrunnen, über oberflächennahe Erdwärmesonden (30 bis 400 m Tiefe) sowie über Tiefbohrungen (1.000 bis 3.500 m Tiefe).
Ein besonders häufiges Verfahren sind oberflächennahe Erdwärmesonden. Dieses Verfahren kommt auch auf der Baustelle für die Labor- und Bürogebäude LAB 1 und 2 zur Anwendung.
Bei Kalten Nahwärmenetzen der Unternehmensgruppe Gemünden wird in der Regel das Verfahren mit oberflächennahen Erdwärmesonden umgesetzt. In Ausnahmefällen kommen auch die Verfahren über Grundwasserbrunnen und Flächenkollektoren zum Einsatz. Die Unternehmensgruppe Gemünden/Molitor realisiert bis dato keine Geothermie über Tiefenbohrungen.
Wie funktioniert ein Kaltes Nahwärmenetz?
Die Kalte Nahwärme ist ein besonders effizientes und ressourcenschonendes Energiekonzept für ganze Quartiere oder Gebäudegruppen mit mehreren Verbrauchern. Hierzu werden die Bohrungen für mehrere Vorhaben zu einem Netz zusammengeschlossen. Jeder Abnehmer verfügt über eine eigene Wärmepumpe, die die aus dem Erdreich gewonnene Energie individuell auf das benötigte Temperaturniveau hebt.
Um die Wärme aus dem Boden nutzbar zu machen, werden sogenannte Geothermiebohrungen durchgeführt. Dabei entstehen Bohrlöcher von bis zu 400 Metern Tiefe (in der Regel aber 80 bis 250m), in die Erdwärmesonden eingebracht werden. Diese bestehen aus miteinander verbundenen Rohrpaaren, in denen eine frostsichere Flüssigkeit im geschlossenen Kreislauf zirkuliert.
Die Flüssigkeit nimmt beim Durchströmen die konstante Temperatur des Erdreichs (je nach Tiefe ca. 10 bis 17 °C) auf und transportiert diese an die Oberfläche zurück.
Sie möchten wissen, wie eine oberflächennahe Geothermie-Bohrung im Detail abläuft? Dann schauen Sie sich gerne das folgende Video an!
Die Funktionsweise der Wärmepumpe
Eine Wärmepumpe hebt das Temperaturniveau mithilfe eines strombetriebenen Verdichters an. Im Wärmetauscher verdampft dabei ein Kältemittel, wird verdichtet, erwärmt sich und überträgt die gewonnene Energie auf Heizungs- und Trinkwasser. Anschließend kondensiert es wieder und der Kreislauf beginnt von vorn.
Versorgung ganzer Quartiere
Ein Kaltes Nahwärmenetz überträgt dieses Prinzip vom einzelnen Gebäude auf ganze Quartiere: Es verfügt über ein zentrales Erdsondenfeld oder über mehrere miteinander verbundene kleinere Sondenfelder. In den dort installierten oberflächennahen Erdsonden zirkuliert ein Wasser-Frostschutz-Gemisch, das die Wärme des Bodens aufnimmt. Über eine Ringleitung – bei Bedarf ergänzt durch Oberflächensonden – gelangt dieses erwärmte Trägermedium zu den angeschlossenen Gebäuden. In den versorgten Häusern heben Wärmepumpen mit besonders niedrigem Strombedarf die aus dem Kalten Nahwärmenetz bereitgestellte Energie auf die jeweils gewünschte Temperatur an.
Passives Kühlen
Neben dem Heizen im Winter bietet das Netz zusätzlich die Möglichkeit, die Häuser im Sommer ökologisch und wirtschaftlich sehr sparsam passiv zu kühlen. Die Wärmepumpe entzieht den Räumen dabei überschüssige Wärme, die ins Erdreich zurückgeführt wird. Das ermöglicht sowohl eine passive Kühlung als auch eine aktive Kältebereitstellung.
Kalte Nahwärme ist damit doppelt effizient: Sie sorgt für behagliche Wärme im Winter und angenehme Kühlung im Sommer und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Die Heizung und Kühlung erfolgen vorzugsweise über großflächige Flächenheizungen. Diese sind ebenfalls besonders sparsam und erzeugen zudem sowohl im Sommer beim Kühlen als auch während der Heizperiode ein besonders angenehmes Raumklima.
Vorteile von Kalten Nahwärmenetzen
Kalte Nahwärmenetze sind eine Schlüsseltechnologie für das Heizen und Kühlen der Zukunft. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels.
Die Vorteile:
- Kalte Nahwärmenetze können komplett mit Erneuerbaren Energien betrieben werden (Geothermie) und leisten zugleich einen Beitrag zum Ausgleich der schwankenden Produktion von Windkraft- und Photovoltaikanlagen.
- Sie können zum Heizen und zum passiven Kühlen von Gebäuden eingesetzt werden.
- Aufgrund der niedrigen Temperatur des Wärmemediums entstehen keine Leitungsverluste. Eine Dämmung der Ringleitungen ist daher nicht notwendig. (Geringere Investitionskosten im Vergleich zur konventioneller Wärmeversorgung)
- Da keine Wärmeverluste, sondern Wärmegewinne entstehen, sind große Leitungsdistanzen von bis zu zwei Kilometern möglich.
- Die Kalten Nahwärmenetze sind technisch so entwickelt, das sie auf benachbarte Quartiere oder in der Nachbarschaft entstehende Quartiere erweitert werden können.
- Ein Ausbau des Netzes in Etappen ist problemlos umsetzbar. Damit ist ein Kaltes Nahwärmenetz besonders gut für Neubaugebiete geeignet.
- Auch in Bestandsquartieren lassen sich Kalte Nahwärmenetze schrittweise realisieren.